|
Montag, 12. Mai 2025 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Phytopharmaka: Wie sie wirken und was die Forschung sagtPhytopharmaka, also Arzneimittel pflanzlichen Ursprungs, erleben eine Renaissance. Lange Zeit als «Hausmittelchen» oder gar Aberglaube abgetan, rücken sie zunehmend in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung. Doch wie wirken diese pflanzlichen Arzneimittel und was sagen aktuelle Studien zu ihrer Wirksamkeit?fest / Quelle: apotheken.ch / Dienstag, 3. Dezember 2024 / 21:58 h
Die Kirche als Vernichterin von NaturheilwissenDie Verwendung von Pflanzen zu Heilzwecken hat eine lange Tradition. Schon in der Antike nutzten Menschen die Kraft der Natur, um Krankheiten zu lindern und die Gesundheit zu fördern. Allerdings spielt auch die Kirche eine wichtige Rolle, indem sie Naturheilkunde unterdrückte und Heilerinnen im Mittelalter verfolgte. Die Kirche hatte in dieser Zeit eine dominante Machtposition inne und ihre Lehren und Praktiken hatten einen grossen Einfluss auf das Leben der Menschen.HexenverfolgungIm Mittelalter wurden viele Frauen, die sich mit Heilkräutern auskannten und Kranke behandelten, als Hexen verfolgt und hingerichtet. Diese Verfolgung geschah oft auf Grundlage von Anschuldigungen, die mit dem christlichen Glauben unvereinbar waren, wie z.B. der Umgang mit magischen Kräften oder der Pakt mit dem Teufel.Die Kirche spielte eine Rolle in dieser Verfolgung, indem sie die theologische Grundlage für die Hexenverfolgung lieferte und die Verfolgung aktiv unterstützte. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass die Hexenverfolgung nicht ausschliesslich von der Kirche initiiert oder durchgeführt wurde. Auch weltliche Herrscher und Gerichte waren daran beteiligt. Unterdrückung von WissenZudem hatte die Kirche im Mittelalter ein Monopol auf die Heilkunst. Klöster waren wichtige Zentren der medizinischen Versorgung und Mönche und Nonnen pflegten Kranke und Verwundete. Die kirchliche Medizin basierte jedoch hauptsächlich auf der antiken Humoralpathologie und religiösen Praktiken wie Gebeten und Wallfahrten.Naturheilkundliche Praktiken, die nicht mit den kirchlichen Lehren vereinbar waren, wurden oft als Aberglaube oder sogar als Ketzerei abgetan. Dies führte dazu, dass viele traditionelle Heilmethoden in Vergessenheit gerieten oder nur noch im Geheimen praktiziert wurden. In dieser Zeit ging sehr viel Wissen unwiederbringlich verloren. Verlust von WissenDie Verfolgung von Heilerinnen und die Unterdrückung von Naturheilkunde trugen dazu bei, dass wertvolles Wissen über die Heilkräfte von Pflanzen verloren ging. Viele Heilerinnen wurden hingerichtet und mit ihnen starb auch ihr Wissen. Der Verlust von Wissen hatte danach auch andere Ursachen, wie z.B. die zunehmende Urbanisierung und die Abkehr von traditionellen Lebensweisen.Gründe für die Renaissance von Naturheilkunde und das Interesse an Phytopharmaka gibt es viele. Zum einen wächst das Bedürfnis nach natürlichen Heilmethoden, die sanft und nebenwirkungsarm sind. Zum anderen ermöglicht der wissenschaftliche Fortschritt eine immer genauere Analyse der pflanzlichen Inhaltsstoffe und ihrer Wirkmechanismen. Was sind Phytopharmaka?Phytopharmaka sind Arzneimittel, deren Wirkstoffe aus Pflanzen gewonnen werden. Sie enthalten Extrakte aus Blättern, Blüten, Wurzeln, Rinden oder anderen Pflanzenteilen. Im Gegensatz zu synthetischen Medikamenten, die meist nur einen isolierten Wirkstoff enthalten, zeichnen sich Phytopharmaka durch eine komplexe Zusammensetzung aus. Sie enthalten eine Vielzahl von Inhaltsstoffen, die in ihrer Gesamtheit die therapeutische Wirkung entfalten.Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen von Phytopharmaka gehören:
Die Wirkungsweise von Phytopharmaka ist komplex und oft noch nicht vollständig erforscht. Im Gegensatz zu synthetischen Medikamenten, die meist auf einen spezifischen Rezeptor oder ein Enzym wirken, entfalten Phytopharmaka ihre Wirkung oft über mehrere Mechanismen. |
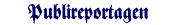
|
|
|
Der Datenanalyst - Ein Beruf mit Gegenwart und Zukunft Im digitalen Zeitalter und angesichts der kontinuierlich ansteigenden Datenmengen kommt einem bestimmten Berufsfeld immer grössere Bedeutung zu: dem Datenanalysten. Doch was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung, und welche Aufgaben übernimmt ein Datenanalyst? Verschaffen Sie sich einen Überblick über den gefragten Beruf Datenanalyst und über alle Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schweiz. Fortsetzung
Schweizer Freihandelsabkommen im Check: Wer profitiert wirklich? Die Schweiz ist bekannt für ihre zahlreichen Freihandelsabkommen (FHA). Doch wie gut werden diese Abkommen tatsächlich genutzt? Fortsetzung
Arbeitsmarkt Appenzell Ausserrhoden: Stabilität und Wandel im April 2025 Im Kanton Appenzell Ausserrhoden zeigt sich im April 2025 ein differenziertes Bild der Arbeitsmarktlage. Während die Zahl der Stellensuchenden leicht gesunken ist, bleibt die Arbeitslosenquote stabil. Ein genauerer Blick offenbart sowohl positive Entwicklungen als auch Herausforderungen, die es zu beachten gilt. Fortsetzung
Winterthur: Eisweiher-Quartier setzt auf zukunftsweisende Wärmeversorgung Das Eisweiher-Quartier in Winterthur beschreitet einen vielversprechenden Weg in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Anstelle von Erdgas wird die Wärmeversorgung künftig durch die Nutzung von Abwärme aus der städtischen Kehrichtverwertungsanlage (KVA) sichergestellt. Fortsetzung
Wenn die Tage zur Belastung werden: Was wirklich bei PMS hilft Einmal im Monat kann sich der weibliche Körper anfühlen wie eine ungeliebte Baustelle. Stimmungsschwankungen, Unterleibsschmerzen, Müdigkeit - die Liste der Beschwerden, die mit dem prämenstruellen Syndrom (PMS) einhergehen können, ist lang und vielfältig. Doch Betroffene sind diesem monatlichen «Blues» nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die Linderung verschaffen und die Lebensqualität in diesen Tagen verbessern können. Fortsetzung
Frühjahrszeit bedeutet Herausforderung für Allergiker: Wie Betroffene ihre Augen schützen können Die alljährliche Pollensaison stellt für einen wachsenden Teil der Bevölkerung eine erhebliche Belastung dar. In der Schweiz leidet mittlerweile jeder fünfte Mensch an Heuschnupfen, eine Entwicklung, die sich seit den 1970er-Jahren mit einer Verdopplung der Betroffenenzahlen manifestiert hat. Verstärkt durch den Klimawandel, der zu verlängerten und sich überschneidenden Pollenflugzeiten führt, suchen Allergiker nach effektiven Strategien, um ihre Beschwerden zu mildern. Fortsetzung
Umfassende Analyse der Materialflüsse veröffentlicht: Potenziale des Schweizer Holzes Holz zählt zu den nachhaltigsten, nachwachsenden und klimafreundlichen Materialien unserer Zukunft. Doch wie viel Holz ist tatsächlich verfügbar und wie können wir es bestmöglich nutzen? Forschende der Empa und WSL haben nun die Materialflüsse von Holz in der Schweiz umfassend untersucht und daraus bedeutende ungenutzte Potenziale identifiziert. Fortsetzung
Pflanzliche Kraft bei Husten: Natürliche Linderung bei Atemwegsinfekten Ein hartnäckiger Husten begleitet oft das Ausklingen von Atemwegsinfekten. Doch die Natur bietet wirksame Unterstützung: Pflanzliche Arzneimittel, deren Effektivität durch wissenschaftliche Studien untermauert wird, können die Beschwerden deutlich lindern. Fortsetzung
Ein Ort der Würde und des Gedenkens: Erstes alevitisches Grabfeld in der Schweiz eröffnet Bern erhält eine neue Ruhestätte, die den Bedürfnissen der alevitischen Gemeinschaft entspricht und ein Zeichen für religiöse Vielfalt setzt. Fortsetzung
Glacier 3000: Hochalpines Erlebnis zwischen Gstaad und Les Diablerets Faszination auf 3000 Metern: Wo eine Brücke Gipfel verbindet und das Alpenpanorama zum Greifen nah scheint. Glacier 3000 - ein hochalpines Erlebnis zwischen Nervenkitzel und Naturwunder, leicht erreichbar zwischen Gstaad und Les Diablerets. Fortsetzung
|
|